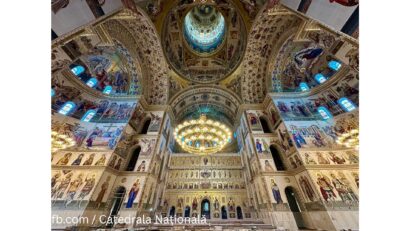Ikonographie der Phanariotenzeit: Pracht, Prunk und Üppigkeit
Die wohlhabenden und politisch einflussreichen Phanarioten haben die Kultur ihrer Herrschaftszeit (1711-1821) stark geprägt. Berüchtigt waren die Pracht und Opulenz, in der die Herrscherfamilien lebten – das zeigen Gemälde aus der Epoche.

Steliu Lambru, 16.03.2020, 17:30
Kennzeichnend für die Kultur des Osmanischen Reiches, dessen starke Offensive nach Zentraleuropa in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht zu stoppen war, war der Zusammenfluss griechischer und türkischer Traditionen. Die Fürsten, die in den rumänischen Fürstentümern Moldau nach 1711 und in der Walachei nach 1716 herrschten, stammten aus wohlhabenden griechischen Familien aus dem vornehmen Viertel Phanar (Fener) in Konstantinopel. Davon ist die Bezeichnung Phanarioten abgeleitet — darunter versteht man einen kleinen Kreis wohlhabender und politisch einflussreicher byzantinischer Adelsfamilien, die im Osmanischen Reich die Oberschicht in Phanar bildeten.
Für manche Strömungen der Historiographie gilt die Phanariotenzeit als eine der dunkelsten in der Geschichte Rumäniens. Diese Zeit war stark von Korruption geprägt: Einige wenige Herrscherfamilien erlangten schnell wirtschaftlichen Wohlstand, während zahlreiche Bauern und Händler, die bis dahin Profit erzielt hatten, auf einmal verarmten. Aus kultureller Sicht gilt die Phanariotenzeit als eine Epoche der sogenannten Griechisierung und Orientalisierung der Sitten, Bräuche und Gepflogenheiten. Die Phanariotenzeit findet 1821, mit dem von Tudor Vladimirescu geleiteten Aufstand ein Ende, als erneut rumänische Adelsfamilien den Thron der Moldau und der Walachei besteigen.
Einige Phanariotenfamilien lassen sich nachträglich Schritt für Schritt rumänisieren, sie werden einheimisch und ihr Erscheinungsbild weist nationalistische und modernistische Züge auf. Die Romantiker haben die Herrschaft der Phanarioten getadelt und sie zum Sündenbock der sozialen und wirtschaftlichen Probleme der Zeit gemacht. Die Phanarioten spielten dennoch bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine ausschlaggebende Rolle nach der Vereinigung der Fürstentümer Moldau und Walachei im Jahr 1859. Der Historiker Adrian-Silvan Ionescu hat die Mode und die Mentalität der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts erforscht, einer von phanariotischen Merkmalen stark geprägten Zeit. Die Üppigkeit der Epoche sei in den aus dieser Zeit datierten Gemälden wieder zu finden, sagt Ionescu:
Die Welt der Phanarioten findet in diesen Gemälden ihre schönste Darstellung. Die phanariotische Zeit war allerdings die Zeit einer überwältigenden Bildlichkeit, sowohl im Wort als auch in der Haltung. Wenn die großen Bojaren sich unterhielten, sprach einer den anderen mit ‚psihi mu‘ (~ ‚meine Seele‘) an. Die Anredeformen kennzeichneten sich durch einen blumigen Stil, das bestätigen die Archivunterlagen, die ich erforscht habe. Was die Kleidung angeht, trug sie starke Akzente der Konstantinopel-Mode, deren Anhänger mit ihrem Reichtum prahlten. Sie wollten Byzanz mit nach Hause bringen, so wie der Historiker Nicolae Iorga in seiner gut argumentierten Theorie »Byzance après Byzance« feststellt.“
Sie trugen prächtige, weite, von Künstlern gefertigte Kleider, die den sozialen Status bestätigten und bei Treffen mit Mitgliedern der internationalen Elite einen starken Eindruck hinterließen. Adrian-Silvan Ionescu kommt erneut zu Wort mit Einzelheiten:
Die Höfe im ostrumänischen Iaşi und in Bukarest zeigten ihre volle Pracht durch das Aussehen ihrer Mitglieder. Es gelang ihnen, sogar die Vertreter kaiserlicher und königlicher Familien Europas zu beindrucken. Einer der größten rumänischen Bojaren, Ienăchiţă Văcărescu, besucht zu jener Zeit die Wiener Hofburg, wo er den Kaiser zu überzeugen versucht, die beiden rumänischen Fürsten, die sich gerade in Wien aufhielten, zu verjagen und sie nach Hause zu schicken. Diese hatten ihre orientalischen Gewänder zugunsten enger, westlicher Kleider abgelegt und sich den Bart abrasiert. Die Gräfinnen und Baronessen des Reiches bewundern die Feinheit und Schönheit des Kaschmirschals, den Văcărescu um die Hüften trug.“
Was fällt besonders in den Gemälden von Bojaren und Bojarinnen auf, die auf die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts datiert sind? Auf den ersten Blick: teure Kleider, Schmuck und Waffen“, sagt Adrian-Silvan Ionescu:
Auf den Gemälden der Zeit sind Pelzmäntel bester Qualität zu merken, so zum Beispiel Zobel- und Hermelinpelz, die seit Jahrhunderten als Kostbarkeit gelten, feine und aufwendige Waffen, prächtige Schmuckstücke, edle Seidenkleider. Diese zeigen die volle Pracht, in der diese Herrscher lebten, die genau wussten, wie man in Rekordzeit reich werden kann. Sie zeigen auch ihren Geschmack. Nähert man sich der Kleidung der Zeit, dann fällt es aus Sicht der Chromatik und des Stoffes auf, dass sie einem perfekten Geschmack entsprechen. Die Farben passten gut zusammen, das gleiche galt auch für die Stoffe, sie trugen ihre Kleider sehr stolz, denn sie bestätigten ihren sozialen Status. Bekanntlich gab es drei Ränge in der Hierarchie der Bojaren und zudem eine zweite und dritte Kategorie in der Rangordnung. Für jede Schicht sind spezifische Kleidungs- oder Schmuckstücke typisch. Keiner durfte über die eigene soziale Position hinweg teurere Kleidungsstücke tragen. Eine ausschlaggebende Rolle spielte das Aussehen des Gesichtes. Der Bart war Kennzeichen der Bojaren erster Kategorie, während die Bojaren zweiter und dritter Kategorie nur Schnurrbart tragen durften. Sollte ein Bojar im Rang aufsteigen, dann durfte er die Kleidungs-und Schmuckstücke der erstrangigen Bojaren tragen. Zudem stutzte der Barbier des Fürsten den Umriss des Bartes mit seinem Barbiermesser ziemlich genau zurecht und kümmerte sich auch nachträglich um den Gesichtsschmuck des geadelten Bartträgers. Das war das Zeichen dafür, dass er nunmehr genau wie erstrangige Bojaren einen Bart tragen durfte.“
Viele haben die Mode der Phanarioten verabscheut, sie weckt dennoch im rumänischen Kulturraum eine gewisse Nostalgie. Dazu Adrian-Silvan Ionescu:
Die Mode der Phanarioten prägt sehr stark die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, selbst wenn der von Tudor Vladimirescu geleitete Aufstand der Herrschaft der Phanarioten ein Ende setzt. Eine Wiederbelebung dieses Stil ist Mitte des 19. Jahrhunderts, genauer um 1860-1865 festzustellen, als die kurze Jacke mit weit geschnittenen und mit einem Riss auf der Seite vorgesehenen Ärmeln, mit aufgestickten Fäden wieder in die Damenmode kommt. Bei Kostümfesten trugen noch einige, die die phanariotische Mode in ihrer Kindheit kennengelernt hatten, spezifische Kleidungsstücke aus dieser Zeit zur Belustigung der Anwesenden.“
Die Ikonographie der Epoche zeigt eine untergegangene Welt, eine Welt der Üppigkeit und des Wohlstands. Es handelte sich aber um den exklusiven Wohlstand der Elite, die an ihrem Rang und sozialen Status trotz trüber Zeiten festhielt.